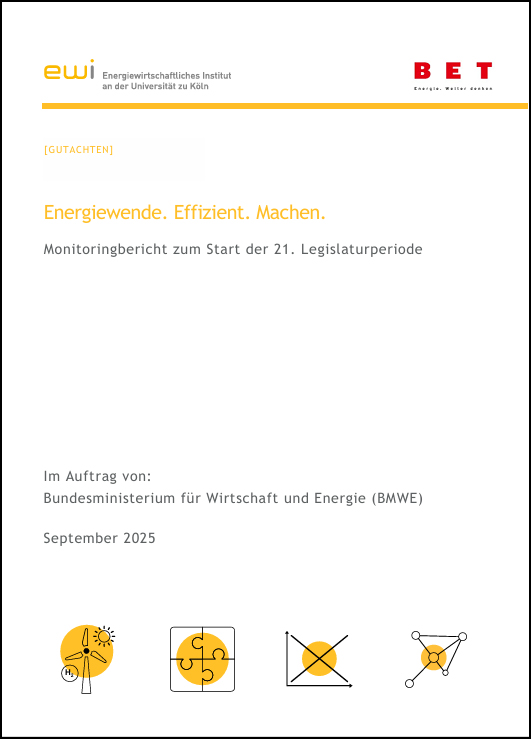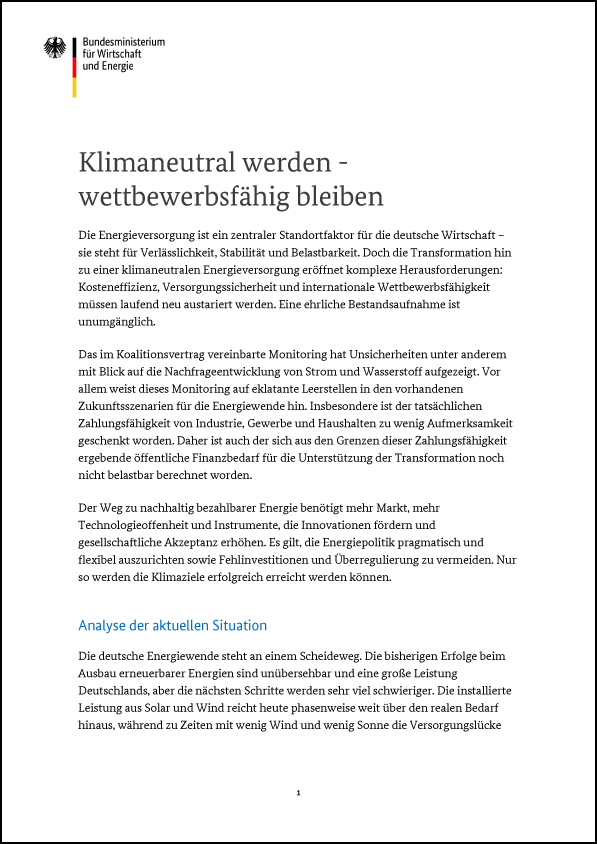Die Kolumne von Hans-Jochen Luhmann (September 2025)
Die gegenwärtig zu vollziehende Energiewende hin zu Erneuerbaren ist von historischer Dimension: zu ihr gehört ein erheblicher Sprung in Energieeffizienz, man benötigt für denselben Bedarf nur mehr etwa knapp die Hälfte bis ein Drittel als Energieinput, zugleich wird alle Luftreinhaltepolitik überflüssig, welche die Begleitgase der Verbrennungsprozesse einzudämmen suchte. Katherina Reiche leitet im neuen Bundes-Kabinett das Ministerium für „Wirtschaft und Energie“ und ist, wie wir wissen, eine kluge und professionelle Frau, die weiß, wovon sie redet…

1. Einleitung
Katherina Reiche leitet im neuen Bundes-Kabinett das Ministerium für „Wirtschaft und Energie“ (BMWE). Der Zuschnitt des Hauses war in der Legislaturperiode zuvor noch ein anderer, im BMWKE waren die Klima- und die Energieabteilung zusammengeführt worden. Klimapolitik ist für sich ein zahnloser Tiger, die Musik der Gestaltungsmacht spielt hingegen beim Energiethema. Frau Reiche ist somit die eigentliche wenn auch inoffizielle Ministerin für die Gestaltung der Klimapolitik in Deutschland. Die Klimaabteilung wurde an das Umweltministerium zurückverschoben, der dortige Minister von der SPD ist aber mehr ein Buchhalter der klimapolitischen Entwicklung in Deutschland – er hat nichts zu sagen, er kann sich lediglich zu Wort melden.
Frau Reiche ist angetreten mit einem außerordentlichen kommunikativen Stil. Sie gibt sich in ihren öffentlichen Äußerungen das Image einer Sphinx. Was sie zur Energiepolitik sagt, ist regelmäßig mehrdeutig. Sie bedient kalkuliert populistische Vorstellungen und lässt im Unklaren, was, präzise gesprochen, denn nun Sache sein soll.
Das verführt dazu, sie in eine Reihe zu stellen mit anderen Kabinettsneulingen, die ebenfalls so zu reden scheinen, aber offenkundig nur deshalb, weil sie noch nicht wissen, was sie im Detail wollen. Bei Frau Reiche ist das anders, sie ist Vollprofi. Ihr bisheriger beruflicher Lebenslauf erweist das:
- Sie war seit ihrem Studium in der Politik, gelangte bis in das Amt einer stellvertretenden Vorsitzenden der Fraktion von CDU und CSU im Deutschen Bundestag;
- wurde dann Lobbyistin, ging als Hauptgeschäftsführerin zum Verband kommunaler Unternehmen (VkU);
- und schließlich wurde sie Leiterin von Westenergie, der Eon-Tochter, in der deren Stadtwerke-Beteiligungen gesammelt sind. Die Bedeutung dieses Unternehmens wird schlaglichtartig deutlich durch den Hinweis, dass es über 1.600 Konzessionsverträge und kommunale Partnerschaften hält.
Kommunale Energieunternehmen haben ihren Wert durch Investitionen in Infrastrukturen, das sind Leitungen für Wasser, Gas und Elektrizität. Hinzukommen etwaige Kraftwerksbeteiligungen.
Vor diesem Hintergrund ist Frau Reiche im März 2025 wieder in die Politik gewechselt. An den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag, zu Energie und Klima in AG 15 unter Leitung von Andreas Jung, einem big shot von der CDU in Klima- und Energiefragen, hatte sie noch nicht teilgenommen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe im Koalitionsvertrag aber sind nun ihre Vorgabe, die hat sie nun zu interpretieren und auszuführen. Viele ihrer formelhaft wirkenden Sätze sind denn auch eigentlich Zitate aus dem Koalitionsvertrag. Und Andreas Jung spricht übrigens auch nicht viel anders. Zu den Vorgaben gehörte auch die Pflicht, eine Bestandsaufnahme der Energiewende in Auftrag zu geben.
2. Hintergrund: Das Wesen der Energiewende
Die gegenwärtig zu vollziehende Energiewende ist von historischer Dimension. Sie ist ein fundamentaler Übergang:
- Verlassen wird das Energiesystem, welches mit der Industriellen Revolution begonnen wurde, dem Zugriff auf den in fossilen Energieträgern chemisch gespeicherten Energievorrat aus Jahrmillionen Erdgeschichte.
- Übergegangen wird auf ein Energiesystem, welches die rezenten Energieflüsse der Atmosphäre abgreift.
Die Pointe dieses Wechsels ist, dass die geernteten erneuerbaren Energien bereits in der wertvollsten Form vorliegen, das ist als Elektrizität, als „Kraft“ (power) – und der Einsatz von Elektrizität ist fast verlustfrei möglich. Schon um hingegen aus chemisch gespeicherten Energieträgern Kraft zu produzieren, sei es Elektrizität, sei es direkt zum Antrieb im Kraftfahrzeug, muss man den Energieträger erst verbrennen. Dieser thermische Umweg zur Gewinnung von Kraft verschleudert Unmengen von Energie, die geht als Abwärme, in der Regel als Verlust, in die Umwelt.
Zum Wesen der Energiewende gehört somit ein erheblicher Sprung in Energieeffizienz, man benötigt für denselben Bedarf nur mehr etwa knapp die Hälfte bis nur ein Drittel als Energieinput. Wir benötigen nurmehr die Hälfte an Energie gegenüber dem Systemzustand zuvor. Zugleich wird alle Luftreinhaltepolitik, welche die Begleitgase der Verbrennungsprozesse einzudämmen suchte, überflüssig. Strom wird, anders als früher, der dominante Endenergieträger. Wir fahren in Zukunft Auto mit Strom und Heizen mit Strom (Wärmepumpe).
Bei dieser Wende gibt es natürlich auch Kehrseiten. Kraftwerke nach dem Verbrennungsprinzip gab es nur wenige, die chemisch gespeicherte Energie wurde zu ihnen via Straßen, Bahnen und Schiffen transportiert. Die Kraftwerke erzeugten daraus konzentriert Strom und verteilten den dann überwiegend in ihrer jeweiligen Nachbarschaft. Hochspannungsleitungen, die die großen Kraftwerke miteinander verbanden, gab es in dieser Epoche ebenfalls, aber sie wurden nur selten zum Transport großer Mengen genutzt. Deswegen wurden sie als Wechselstromleitungen konzipiert, trotz der damit verbundenen hohen Transportverluste. Sie waren eben nur „Verbundleitungen“, zur Abdeckung des Risikos eines Kraftwerks-Ausfalls – die heutigen Netze hingegen haben eine ganz andere Funktion, sie sind „Übertragungsnetze“, sie sind explizit für den Transport da, deswegen werden für den Ferntransport auch zunehmend die verlustarmen Gleichstromleitungen zugebaut. Die erneuerbare Energie wird dezentral eingefangen, und da muss selbstverständlich das Netz eine neue Qualität bekommen, weil es ganz andere Funktionen im Stromsystem hat als früher. Und im großräumigen Verbund gleichen sich die Wetterlagen zudem tendenziell aus, je weiträumiger der Verbund, desto geringer der Bedarf an ausgleichenden Erzeugungsanlagen in wetterbedingten Mangelsituationen.
Aus dieser Darstellung wird Zweierlei deutlich, was massive Herausforderungen für die intergenerationelle Gerechtigkeit in der Gegenwart impliziert. Um die zu verstehen, hat man aber noch eine Rahmenbedingung einzuführen. Auf Initiative der marktliberalen Brüsseler EU-Kommission und ohne Bedenken der klimapolitisch bedingten anstehenden Energiewende ist im Stromsektor, beginnend in den späten 1990 Jahren, das Wettbewerbsprinzip eingeführt worden. Maxime war: Wettbewerblich machen, was wettbewerblich geht. In der Konsequenz wurden die bis dahin üblichen Monopole beziehungsweise Angebote aus einer Hand abgelöst durch zwei Elemente, die nun, in Europa, konstitutiv sind für die Wende:
- den „Electricity only Market“ (EoM): Der besagt, dass Wettbewerb nur nach den Betriebskosten des (bestehenden) Kraftwerksparks stattfindet. Die Kraftwerke sollen optimal, das ist kostengünstig, zum Einsatz gebracht werden. Als es noch Grundlast- (Braunkohle und Kernkraft), Mittellast- (Steinkohle) und Spitzenlast- (Erdgas) Kraftwerke gab, wurden die von alleine dem EoM-Prinzip gemäß eingesetzt, weil auf den (globalen) Bezugsmärkten Erdgas teurer war als Steinkohle, die aber teurer als Braunkohle und Kernbrennstoffe. Allerdings wurde nur im Bereich des jeweiligen Monopolisten so optimiert. Mit dem EoM wird der Einsatz nun übergreifend optimiert.
- Die übrigen Leistungen im Strombereich, wie Transport über Leitungen, Aufwand zur Systemstabilisierung, Reserve-Kraftwerke und so weiter, werden von den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB), die weiterhin Gebiets-Monopolisten sind, gegen Kostenerstattung in Auftrag gegeben beziehungsweise erbracht. Zur Refinanzierung werden diese Gemeinkosten den Kunden insgesamt, ohne Differenzierung, als Aufschlag in Rechnung gestellt, und zwar proportional zur bezogenen Strommenge. Damit entfällt die bislang sachlich berechtigte Differenzierung, dass die Verbraucher nur für den Netzteil zahlen, den sie in Anspruch nehmen, die Großverbraucher also nur für die Hochspannungsebene. Für die energieintensiven Industrien ist die diesbezügliche Änderung ein erheblicher wettbewerblicher Nachteil.
Die beiden implizierten Herausforderungen für die intergenerationelle Gerechtigkeit sind:
- Das überkommene Stromnetz muss nun, in nur zwei Jahrzehnten, massiv um- und ausgebaut werden. Das erfordert Infrastruktur-Investitionen in erheblichem Umfang, die nach dem Prinzip der Umlage anfallender Kosten der aktuellen Generation in Rechnung gestellt werden. Den Wert des gewendeten Stromnetzes aber werden die Generationen danach günstig, da amortisiert, nutzen können. Es handelt sich bei den hohen Netzkosten um ein temporäres Phänomen, welches durch einen intergenerationellen Verteilungsmechanismus entschärfbar wäre.
- Energieträger fossiler Herkunft werden funktionslos, das gilt auch für Erdgas. Die Besonderheit von Erdgas gegenüber Kohle und Ölprodukten ist, dass er der einzige leitungsgebundene Energieträger unter ihnen ist, soll sagen mit einer Transportinfrastruktur, die nur auf ihn zugeschnitten ist – für Öl (Pipelines) gilt das zwar auch, aber lediglich für den Ferntransport. Erdgas selbst nicht länger mehr zu beziehen, betrifft nur die Lieferanten auf dem Weltmarkt, da muss man lediglich dafür Sorge tragen, dass die Importunternehmen nicht zu langfristig bindende Abnahme-Verträge schließen. Das mit dem Abschied vom Erdgas verbundene massive wirtschaftliche Problem stellen vielmehr die Gasleitungen dar, darunter insbesondere die Gasverteilleitungen. Letztere haben eine Gesamtlänge von rund 520.000 Kilometern. Sie liegen, unter Bedingungen, die in Konzessionsverträgen formuliert sind, auf kommunalem Gebiet, im Eigentum von Stadtwerken beziehungsweise externer Unternehmen, die den Betrieb für die Kommunen übernommen haben. Solche Unternehmen sind es, die in Westenergie gebündelt worden waren, der Wert dieser Leitungen ist für den VkU ein zentrales Thema. Hinzukommt, dass die Gasnetze nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur nur über rund 60 Jahre abgeschrieben beziehungsweise amortisiert werden dürfen, nicht kürzer – das Klimaneutralitätsziel in 2045 war bei den Beschlusskammern der Bundesnetzagentur offenbar verschlafen worden. Die Gasverteilnetze in Deutschland sind im Schnitt knapp 30 Jahre, also erst halb so alt. Da ist noch viel an „Buchwert“ abzuschreiben. Frau Reiche ist sich somit dessen bestens bewusst, welches Vermögensrisiko für kommunale Versorger und also auch für die Kommunen in einem Ausstieg aus der Versorgung mit Erdgas liegt.
3. Das Ergebnis des Monitorings der Energiewende
Das Monitoring war im Koalitionsvertrag vereinbart und von der Ministerin umgehend nach Amtsantritt in Auftrag gegeben worden. Vorgelegt wurde das Ergebnis am 16. September 2025 von einem Konsortium zweier Unternehmen mit bester Expertise im Energie- und insbesondere im Stromsystem. Hier deren Bericht.
Zeitgleich veröffentlichte das Ministerium seine Sicht der Konsequenzen, die aus diesem Monitoring-Bericht zu ziehen seien. Die steht unter der Überschrift „Klimaneutral werden – wettbewerbsfähig bleiben“. Wer das programmatisch verschwiegene Handeln der EVP-Fraktion in Brüssel verfolgt, weiß diesen Titel in Klartext zu übersetzen: „Irgendwann klimaneutral werden, also die Energiewende vollziehen, jetzt aber beschränken auf das wettbewerblich Zumutbare“. Die dabei leitenden Hintergrundmotive sind damit noch nicht genannt: den Rechten ihren Themen nehmen, indem man sie selbst vollzieht. Und Trumps Forderungen weit entgegenkommen, um den militärischen Schutzschirm der USA nicht in Frage zu stellen. Außerdem gibt es haushaltspolitische Gründe: Die Umorientierung auf Aufrüstung entzieht der Energiewende die unterstützenden staatlichen Mittel, sie wird ohne diese Mittel, allein durch erhöhte Preise finanziert, politisch untragbar.
Liest man diesen Text aus dem BMWE, dann wird deutlich, dass man Reichelogie betreiben muss, um zu verstehen, was gemeint sein könnte – Klartext ist das nicht. Hier beispielhaft ein paar „Schmankerl“ aus diesem Text:
- „Die installierte Leistung aus Solar und Wind reicht heute phasenweise weit über den realen Bedarf hinaus, während zu Zeiten mit wenig Wind und wenig Sonne die Versorgungslücke nur durch fossile Erzeuger oder Importe geschlossen werden kann.“
Da wird eine Binsenweisheit in Worte gefasst. Sie wird aber so formuliert, als wenn es sich um ein Problem, und dann noch ein abstellbares, handele. Der großräumige Ausgleich über regionale Wetterzonen hinweg gehört eben zu den Effizienzpotentialen des Stromsystems – die Unterstellung, dass Importe etwas Schlechtes seien, hat einen nationalistischen Anklang. - „Die Annahme, dass Strom aus erneuerbaren Energien praktisch zum Nulltarif zur Verfügung gestellt werden kann, ist bei Berücksichtigung des Gesamtsystems falsch – durch diese verkürzte Sichtweise entstehen enorme wirtschaftliche Risiken. Photovoltaikanlagen und Windkrafträder produzieren nur, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Da der Strom aber unabhängig davon immer gebraucht wird, reichen die erneuerbaren Energien allein nicht aus – das Resultat sind hohe Investitionen in das gesamte Stromsystem.“
Die Unterstellung im Eingangsteil des Satzes ist schon perfide. Die Annahme, dass „Strom aus erneuerbaren Energien praktisch zum Nulltarif zur Verfügung gestellt wird“ ist, auf Betriebskosten bezogen, schließlich korrekt – das herrschende Marktsystem stellt darauf (nur) ab. Es ist eben bekanntermaßen der Mangel des herrschenden Strommarktdesigns, dass die Kosten des Gesamtsystems nicht abgebildet und optimiert werden. Statt aber, korrekt, das Marktdesignals Problem anzusprechen, projiziert der Text das Problem fälschlich auf die Erneuerbaren. Dass die Erneuerbaren ein back-up aus gespeicherter Energie benötigen, gehört ebenfalls zum Wesen des nach-fossilen Stromsystems. - „Der Ausstieg aus der Kernenergie und das schrittweise Abschalten der Kohleverstromung bis 2038 ist ambitioniert; stabile, verlässliche Grundlastkraftwerke müssen als Rückgrat der Versorgung neu aufgebaut werden – allen voran durch moderne Gaskraftwerke mit Umstellungsperspektive auf Wasserstoff.“
Diese Textstelle ist geradezu paradigmatisch. Dass die Erneuerbaren– auch – stabile, verlässliche back-up-Kraftwerke brauchen, ist sonnenklar. Dass das aber (sämtlich) Gas-Kraftwerke zu sein haben, ist schon weniger selbstverständlich. Aber klar, wenn es Gaskraftwerke sein sollen, mit der Option, später auf Wasserstoff umzusteigen, dann bietet sich in der Tat für die geringen Einsatzzeiten solcher Anlagen die kostengünstige und schnell zu errichtende Gasturbine an.
Diese Erwartung aber konterkariert der Text durch Einstreuen des Begriffs „Grundlastkraftwerke.“
Warum diese seltsame Betonung? Klar ist: Grundlastkraftwerke sind Kraftwerke mit hohen Einsatzzeiten pro Jahr, technisch wären das dann aufwändig zu konzipierende Gas-und-Dampf-Kraftwerke. „Grundlast“ lässt dann auch anklingen: Das geht es wirklich um einen hohen Verbrauch von Erdgas. Gilt das, so muss das ganze Erdgassystem am Laufen gehalten werden – komplementär liegt nahe: Die Gasverteilnetze in den Kommunen werden durch die „Abschaffung des Heizungsgesetzes“ gerettet werden. Auf dieser Basis dann später einmal auf Wasserstoff zu wechseln, wenn es nicht nur um den seltenen Einsatz in Zeiten von Dunkelflauten geht, erscheint ökonomisch aussichtslos.
Nun ist, wie wir wissen, Frau Reiche eine kluge und professionelle Frau, die weiß, wovon sie redet. Diese Formulierungen sind kein Lapsus. Sie müssen also einen Sinn haben.
Ich vermute, Frau Reiche und ihre Co-Strategen wollen das Prinzip der Stromerzeugung nach dem Verbrennungsprinzip nicht aufgeben, sondern eine Brücke für den späteren Zugriff darauf beibehalten. Das hat eine lange Tradition in diesem politischen Lager. Man erinnere sich an das seltsam beschränkte Energiekonzept von 2010, der damaligen schwarz-gelben Koalition, welches von 80 Prozent aus erneuerbaren Quellen sprach und zu den restlichen 20 Prozent nichts sagte, aus welchen Quellen die stammen sollten. Das war offenkundig für die Kernkraftwerke offengehalten, die aber wurden durch den Merkel-Westerwelle-Ausstiegsbeschluss nach der Katastrophe in Fukushima für immer aus dem System entfernt. Auch jetzt wieder wird das Angezielte nicht benannt. Eigentlich aber liegt es auf der Hand, dass es um die Option für Small Modular Reactors (SMR) aus den USA gehen soll, um die Energiezusage im sogenannten „Trade“-Deal von Turnberry (vom 27. Juli 2025) mit Leben füllen zu können.
Dr. Hans-Jochen Luhmann ist Senior Expert am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH.
Der Monitoringbericht zum Start der 21. Legislaturperiode „Energiewende. Effizient. Machen.“ im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE)von September 2025 steht über diesen Link zum Download als PDF-Datei bereit.
Die Sicht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) auf diesen Monitoringbericht steht über diesen Link zum Download als PDF-Datei bereit.