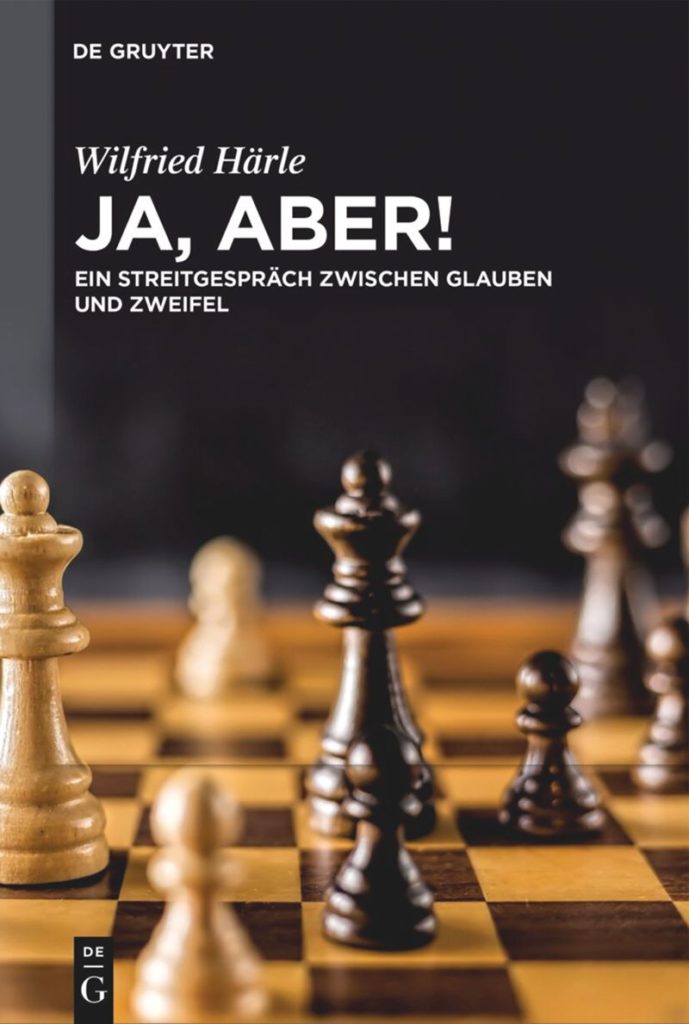„In meiner bisherigen Gemeinde gab es viele junge akademisch gebildete Familien, welche selber oder deren Eltern in den alten Bundesländern geboren und aufgewachsen waren. Kirche gehörte da oft zum guten Ton. Aber seit ein paar Jahren erzählte man mir bei Taufgesprächen oft von der verzweifelten Suche nach Paten. Die glücklichen Eltern fanden selbst unter ihren alten Freunden kaum jemanden, die oder der Pate stehen konnte. Sie wurden im Gegenteil mit der völlig verständnislos geäußerten Frage konfrontiert: »Was, ihr seid noch in der Kirche?«“
So Eckehard Möller, Vorsitzender des Verbands Evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer in Deutschland e. V. vor der Mitgliederversammlung des Verbandes am 23. September 2024 in Kaiserslautern. Möllers Beobachtung ist nicht außergewöhnlich, unzählige Pfarrer*innen berichten von gleichen Erlebnissen. Mangelnde öffentliche Präsenz von Kirche kann nicht Ursache sein, dass ihr die Menschen scharenweise davonlaufen: Regelmäßig finden gottesdienstliche Veranstaltungen statt, per Internet, Fernsehen oder Rundfunk auch übertragen, zu hohen christlichen Feiertagen wird kirchlichen Würdenträger*innen Raum gegeben, sich dem Anlass entsprechend in den Medien zu äußern; außerdem genießen die großen christlichen Kirchen das Privileg, in öffentlichen Schulen Religionsunterricht anzubieten.
Mangelt es den Kirchen und ihren Angeboten schlicht an äußerlicher Attraktivität? Kommen sie einfach nur ein wenig zu „verstaubt“ daher, liegt das Problem also eher an der mehr oder weniger zeitgemäß aufpolierten Oberfläche? Oder wurzelt es tiefer? Überwiegt bei vielen Menschen vielleicht gar schlichtweg der Zweifel am christlichen Glauben dem Glauben oder irgendwelchen seiner Reste selbst?
Einen kleinen Schritt, diesen Graben auszuloten, könnte auf den ersten Blick möglicherweise das anfangs Dezember 2024 erschienene Buch „Ja, aber!“ bieten:
Wilfried Härle: Ja, aber! Ein Streitgespräch zwischen Glauben und Zweifel, Berlin/Boston, Walter de Gruyter GmbH, 2025, 186 Seiten, 29,95 Euro.
Der seit 2006 emeritierte frühere Professor für Systematische Theologie und Ethik an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Wilfried Härle, und sein Verlag hoffen auf private Lektüre oder „Beschäftigung mit diesem Buch in Gemeindegruppen oder im Religionsunterricht“.
Härle breitet in einer Art scholastischem Dialog ein inneres Gespräch zwischen „Glaube“ und „Zweifel“ aus über Fragen, die er als „strittige Grundfragen des christlichen Glaubens, die viele Menschen beschäftigen“ betrachtet: Gottes- und Schöpfungsglauben, Leiden und Tod, Jungfrauengeburt und Gottessohnschaft, Kreuz und Auferweckung Jesu. Er greift dabei zurück auf eine zahlreiche Literatur auch aus seiner eigenen Feder und vor allem auf seine Heidelberger Dialog-Vorlesungen, die sich gezielt nicht allein an ein theologisch gebildetes Fachpublikum wendeten.
Im Vorwort von „Ja, aber!“ bekennt Härle ganz offen: „Am Ende meines Theologiestudiums war ich Atheist, und die Erfahrungen und Argumente, die mich damals dazu gebracht haben, habe ich bis heute nicht vergessen.“ Heute vertritt er „ein Gottesverständnis, dem der Göttinger Philosoph Karl Christian Friedrich Krause Anfang des 19. Jahrhunderts den Namen »Panentheismus«, auf Deutsch: »All-in-Gott-Lehre«, gegeben hat.“ Panentheismus betrachtet die Welt als in Gott enthalten, wobei Gott selbst die Welt übersteigt.
Für das Unternehmen „Ja, aber!“ lässt Härle eine „Position A, die aus Überzeugung den christlichen Glauben evangelischer Konfession“ vertritt und eine „Position B, die den christlichen Glauben ‑ ebenfalls aus Überzeugung ‑ bezweifelt und an vielen Stellen in Frage stellt“ Dialoge führen. Dabei versteht Position A „Gott“ (tatsächlich in Anführungszeichen) als die Macht der uns zur Liebe befähigenden, schöpferischen Liebe und ergänzt: „Wobei ich hinzufügen möchte: Das ist mein Bild bzw. mein Verständnis von der Wirklichkeit Gottes. Ich kann und will nicht behaupten: So ist Gott, und wer Gott anders sieht, sieht ihn falsch.“ (auf Seite 97)
Position B fungiert über weite Strecken als Stichwortgeber für Position A. Das Gespräch erscheint daher weniger als Auseinandersetzung zwischen Glaube und Zweifel, sondern eher als eine Selbstvergewisserung von Position A. Auch zeigt sich, dass die zweifelnde Position B theologisch versiert ist und sich bibelfest zeigt, etwa wenn sie formuliert:
„B: Ich habe nach wie vor insgesamt den Eindruck, daß die Lehre von der Jungfrauengeburt sowohl von ihrer schwachen biblischen Begründung her als auch im Blick auf ihren biblischen Kontext in mehrfacher Hinsicht einen Fremdkörper darstellt: Das beginnt ganz bescheiden mit dem Namen des in Jes 7,14 verheißenen Sohnes, der ‚Immanuel‘ und nicht ‚Jesus’heißt […]“
Das darf selbstverständlich sein, schließlich ist der Dialog zwischen den beiden Positionen ja lediglich fingiert. Und es ist angenehm, dass Position B sich nicht dumm stellt, sondern stets versucht, auf Augenhöhe mit Position A zu agieren. So lässt die zweifelnde Position B ihre Gegenspielerin A durchaus tiefer in ein Thema eindringen und auch von persönlichen Zweifeln reden (etwa auf Seite 146).
Der ganze Tenor des Textes ist allerdings so gehalten, dass man als Leser*in von der Autorität der Theologie und ihrer zitierten Verteter überzeugt sein muss. Häufig läuft es nach dem Schema: Stichwort – theologische Ausführung – Nachfrage – theologische Präzisierung. Stets unter Zuhilfenahme theologischer Überlegungen und Autoritäten, deren Urteil die Leser*innen letztlich vertrauen müssen, oder Verweisen auf die Bibel.
Als Beispiel sei eine Passage von Seite156 zitiert. Da weist Position A auf eine „Überzeugung“ hin,
„die kein Alleinstellungsmerkmal des Christentums ist, aber im Lauf der Geschichte – vor allem im Zusammenhang mit der Überwindung der nationalsozialistischen Verbrechen – weitestgehende grundsätzliche Anerkennung gefunden hat: Das ist die Überzeugung von der unantastbaren Würde aller von Menschen abstammenden Wesen, also von der Menschenwürde.“
Position B wendet daraufhin ein: „Aber das ist doch kein spezifisch christliches Gewächs, sondern vor allem eine Frucht der Aufklärung, die dem Christentum eher kritisch gegenüber stand.“
Und anschließend Position A: „Diese Behauptung gibt einen weitverbreiteten Irrtum wieder. Die Idee der Menschenwürde und der Begriff ‚Menschenwürde‘ sind viel älteren Ursprungs. Die Idee von der gleichen Würde aller Menschen als Männer und Frauen hat ihre Wurzel in der jüngeren biblischen Schöpfungserzählung […]“
„Aufklärung war ursprünglich vor allem der Versuch, Grausamkeit einzudämmen, ja sie vielleicht irgendwann ganz zum Verschwinden zu bringen.“ So der Zürcher Philosoph Michael Hampe. Dabei ist die Grausamkeit, von der Hampe spricht, jene Grausamkeit, die von den christlichen Kirchen biblisch legitimiert war! So viel zum „weitverbreiteten Irrtum“, von dem Härle spricht. Wie war das denn mit „der gleichen Würde aller Menschen als Männer und Frauen“ (Härle) bei der (ablehnenden) Haltung der evangelischen Kirchen, als das Frauenwahlrecht in Deutschland im Jahr 1919 eingeführt wurde? Oder als der Protest und Widerstand der evangelischen Kirchen ausblieb gegen nationalsozialistische Verbrechen in Gestalt von Diffamierung, Entrechtung, Verfolgung, Deportation oder Vernichtung von Menschen?
Richtig wild ist es im Kapitel „Evolutionstheorie und/oder Schöpfungsglaube“. Härle setzt sich hier mit der biologischen Evolution und der physikalischen Kosmologie auseinander.
Zunächst muss festgestellt werden: Das englische Verb „to fit“ steht für das deutsche Verb „passen“. In Darwins Evolutionstheorie beschreibt folglich der Ausdruck „Survival of the Fittest“ das Überleben der am besten an ihren Lebensraum angepassten Individuen. Dann: Was Härle mit Stichworten wie „Wirkursache“, „Zielursache“, „immateriellen Realitäten“ oder „panpsychistische Metaphysik“ nach dem „Woher“ von Evolution schreibt, bleibt bei Licht betrachtet zum größten Teil einfach Spekulation, die man glauben kann, jedoch nicht muss, und die kein Wissen über den betrachteten Gegenstand erzeugt, das außerhalb theologischer Kreise tragfähige Gültigkeit zu beanspruchen in der Lage ist.
Der Mainzer Philosoph Thomas Metzinger hat es schön formuliert: „Da gibt es eine ganze akademische Disziplin an deutschen Universitäten, die heißt Erkenntnistheorie, das ist eine Unterdisziplin der Philosophie. Da beschäftigen sich Leute damit, was Wissen ist.“ Und bei ihrer kritischen Betrachtung von Wissensproduktion etwa in der Biologie oder der Physik tauchen diese Philosoph*innen ganz tief in die entsprechenden Wissenschaften ein und nehmen sie inhaltlich ernst, um etwa Fragestellungen zum Verhältnis von Modellen und Wirklichkeit, zur Determiniertheit von Vorgängen oder zur Validität oder Reliabilität von Ergebnissen empirischer Forschung bearbeiten zu können.
Man hat den Eindruck, dass Härle hingegen nicht tiefer in die Materie eindringen will oder kann, wie es etwa Philosoph*innen gelingt. Härle scheint „Rosinen pickend“ im Blick auf naturwissenschaftliche Ergebnisse mit seiner Scholastik vor allem teleologische Tendenzen in der Natur belegen zu wollen. Das riecht ein wenig nach Auseinandersetzungen zwischen mechanistischen und teleologischen Naturerklärungen aus dem 18. Jahrhundert. Da geht es dann im Grunde genommen letztlich um den Nachweis einer göttlichen Weltordnung – mit der jene Grausamkeit übrigens begründet war, deren Eindämmung sich die Aufklärung auf die Fahnen geschrieben hatte. Seit damals hat sich die Welt der Wissenschaften allerdings weitergedreht.
Auch ist das ganze Unternehmen Wissenschaften metaphysisch verankert. Selbst der „reine“ Naturalismus von Naturwissenschaften kommt ohne metaphysische Voraussetzungen nicht aus (er muss etwa zumindest die Existenz von Phänomenen außerhalb des menschlichen Bewusstseins voraussetzen oder die Tatsache, dass es in der Welt „mit rechten Dingen zugeht“), wie die Forscher*innen selbst wissen.
Diese Forscher*innen haben Verfahren entwickelt, über Beobachtung und gezieltes Experimentieren zu tragfähigen wissenschaftlichen Resultaten in ihren Disziplinen zu gelangen. Für die Physik hat das Richard Feynman, einer der Väter der Quantenelektrodynamik, schön formuliert, wie das funktioniert: „Im Allgemeinen suchen wir nach einem neuen Gesetz mit Hilfe des folgenden Verfahrens: Zunächst vermuten wir es. Dann berechnen wir die Folgen der Vermutung, um zu sehen, was das Gesetz, das wir vermutet haben, bedeuten würde, wenn es zuträfe. Dann vergleichen wir das Ergebnis der Berechnung mit der Natur, durch Experiment oder Erfahrung, vergleichen es direkt mit der Beobachtung, um zu sehen, ob es stimmt. Wenn es nicht mit dem Experiment übereinstimmt, ist es falsch. In dieser einfachen Aussage liegt der Schlüssel zur Wissenschaft. Es macht keinen Unterschied, wie klug Sie sind, wer die Vermutung angestellt hat oder wie sein Name ist ‑ wenn es nicht mit dem Experiment übereinstimmt, ist es falsch. Das ist alles.“
Wilfried Härle verlässt sich bei seiner Suche nach teleologischen Tendenzen in der Natur lieber auf das virtuose Jonglieren mit plakativen populärwissenschaftlichen Begrifflichkeiten, die sich zu diesem Zweck gut handhaben lassen. Seine Ausführungen beispielsweise von einem „explodierenden Atom“ etwa zu Beginn von Raum und Zeit sind in mehrfacher Hinsicht falsch und irreführend. Das gesamte Universum war Sekundenbruchteile nach seiner Entstehung bereits komplett vorhanden – allerdings nicht in seiner gegenwärtigen Gestalt mit der jetzt zu beobachtenden Verteilung von Materie und Energie. Mit dem Universum entstanden erst Raum und Zeit. Dass Physiker*innen nicht sagen können, was „vor“ dem „Urknall“ war oder „woher“ er kam oder „warum“ er stattfand, wissen sie selbst; und sie tun – im Gegensatz zu Theolog*innen – auch nicht so, als wäre das anders. Es herrscht übrigens eine rege und hochinteressante Debatte über die philosophischen und auch religiösen Implikationen des kosmologischen Standardmodells (sehr gut dargestellt etwa von Stefan Bauberger SJ, der Physiker und katholischer Priester ist und an der Hochschule für Philosophie München Naturphilosophie und Wissenschaftstheorie lehrt).
Mit „Ja, aber!“ erreicht Wilfried Härle nicht einmal ansatzweise das Niveau dieser Diskussion. Seine Beiträge dazu bleiben eher oberflächlich, lückenhaft und beliebig. Und das ist schade. So werden nämlich seine „Ja, aber!“-„Anfragen“ durch die Naturwissenschaften an den Glauben – um die es ja schließlich geht – letztlich nur solche Menschen teilen können, die den gleichen Missverständnissen und Vorurteilen unterliegen wie Härle auch. Andere hingegen bleiben allein gelassen mit ihren Anfragen. Der paternalistisch belehrende Ton, mit dem Härle Resultate wissenschaftlicher Arbeit abmeiert, ist darüber hinaus derart ärgerlich, dass es Mühe kostet, sich nach Lektüre des Kapitels „Evolutionstheorie und/oder Schöpfungsglaube“ noch weiter mit dem Buch zu beschäftigen.
„Ist christlicher Glaube heute überhaupt noch ehrlich möglich?“, fragt Wilfried Härle in der Überschrift zum letzten Kapitel. „Ja, sicher!“, kann man da nur antworten. Gott hat uns schließlich unseren Verstand gegeben, dass wir uns in der Welt zurechtfinden können. Ob wir allerdings in der Kirche Antworten erhalten auf Fragen, die sich uns dabei stellen, steht auf einem anderen Blatt. Vielleicht sollte die Theologie einfach mal versuchen, fragenden Menschen gegenüber ihre „Ja, aber!“-Haltung aufzugeben.
Dr. Michael Wildberger.