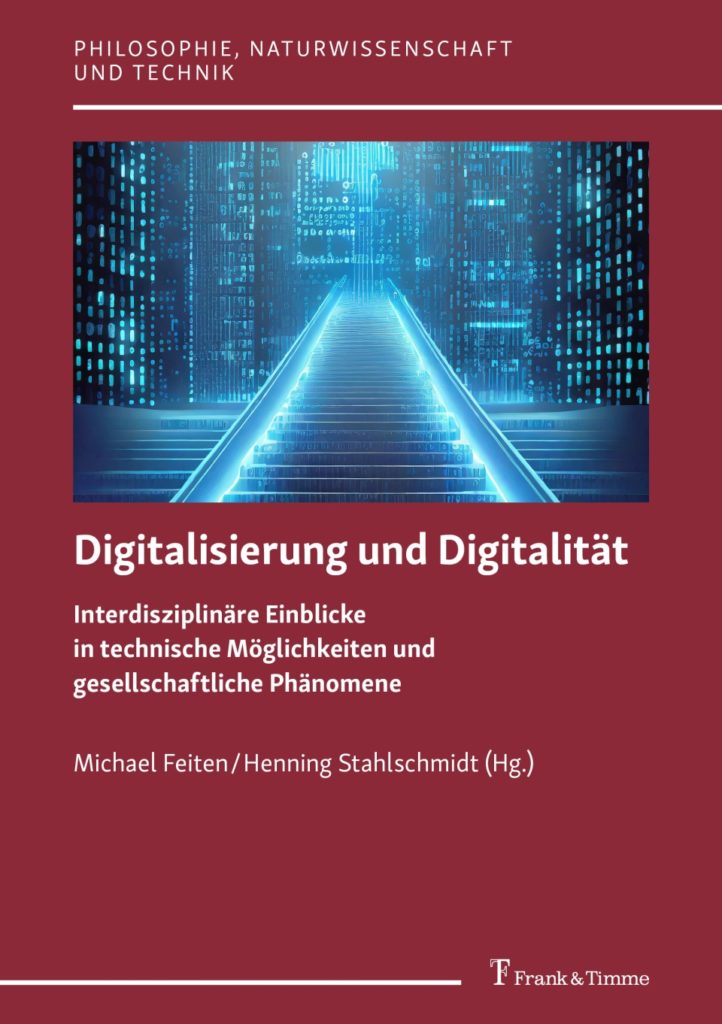Für den kommunikationsaffinen Computer-User waren die in den 1990ern aufkommenden Plattformen wie Skype ein unerwarteter Segen: konnte man doch endlich ohne die lokal anfallenden Telefonrechnungen nun fast gratis und nahezu formlos rund um den Globus telefonieren und Nachrichten austauschen ‑ zunächst nur als SMS ‑, nicht viel später gab es bereits Bildübertragungen. Mit WhatsApp änderte sich die Cyber-Welt ein weiteres Mal grundlegend.
Das Aufkommen der sogenannten sozialen Medien wie Facebook, Twitter und Instagram hat letztlich die Art, wie Menschen miteinander kommunizieren, ein weiteres Mal grundlegend verändert. Sie erlauben es, Texte wie Bilder und Videos einfach mit anderen zu teilen, zu bewerten und eigene Meinung zu transportieren.
Hinter diesem Angebot trat allerdings der eigentliche Zweck all dieser Systeme in den Hintergrund: Das krakenartige Sammeln von Daten. Dies wurde von den Nutzern meist gar nicht wahrgenommen – und falls doch, hinsichtlich der Auswirkungen oft abgetan mit Worten wie: „Ich habe doch nichts zu verbergen.“ Es blieb – rein objektiv gesehen – auch nur eine Alternative: entweder die sogenannten „Datenschutzbestimmungen“ zu akzeptieren oder sich aus der Teilhabe an der weltweiten Kommunikation zu verabschieden. Dieses Dilemma lebt in vielerlei Gestalt fort. Die weltweite digitale Kommunikation ist „in Händen“ weniger Tech-Giganten, die nahezu alles in den Griff bekamen, was irgendwie zu Geld zu machen ist: Das neue Gold sind die Daten der Milliarden user.
Michael Detjen und Rudolf Tillig haben mit ihrem Aufsatz unter dem sperrigen Titel „Die Monetarisierung von Daten: Warum individuelle Eigentumsrechte dringend erforderlich sind“ im Sammelband „Digitalisierung und Digitalität“ den Finger in die Wunde gelegt:
Michael Feiten (Hg.), Henning Stahlschmidt (Hg.): Digitalisierung und Digitalität. Interdisziplinäre Einblicke in technische Möglichkeiten und gesellschaftliche Phänomene, Berlin, Frank & Timme, 2024, 450 Seiten, 49,80 Euro.
Denn Detjen und Tillig sehen die Parität, die allerdings in kapitalistischen Systemen selten gegeben ist, dadurch eklatant verletzt, dass die Datengeber für das nahezu lückenlose Zurverfügungstellen ihrer persönlichen Daten von den Anbietern mit den Peanuts des Kommunizierendürfens (noch weitgehend zum Nulltarif) abgespeist werden. Sie vergleichen die aktuelle Situation mit derjenigen, in denen sich die aufkommende Arbeiterschaft des 19. Jahrhunderts gegenüber den Fabrikbesitzern befand. Die kämpfte für das Recht auf ökonomische Beteiligung. Arbeit bedeutete für sie nicht nur Unterhalt und Sicherung der eigenen Existenz, sondern Teilhabe, Partizipation als souveräne Subjekte am ökonomischen Prozess. Arbeit ist Teil personaler Selbstverwirklichung oder anders gesagt: unverzichtbares Instrument der Menschwerdung. Wer Menschen die Arbeit nimmt, sie wegrationalisiert oder neu wegalgorithmisiert, startet einen Angriff auf den Menschen und sein Menschsein selbst.
Im Blick auf die Datensammelwut vor allem der „Big Five“ – Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram) Apple und Microsoft – fordern die Autoren angemessene monetäre Lösungen für den Verkauf persönlicher Daten an Dritte. Deren Form lassen die Autoren noch offen, deuten allerdings an, dass es aufgrund des Machtgefälles zwischen Dateninhaber und Datennutzer kaum solche auf individueller Basis geben könne. Es bedürfe einer „Arbeiterbewegung 2.0“, diesmal also die Verhandlung nicht über den Wert der körperlichen Arbeitskraft, sondern über den Wert individueller Daten, die kollektive Regelungen als Ergebnis haben müsste und damit eine neuartige Partizipation am ökonomischen Prozess in Zeiten Künstlicher Intelligenz.
Das Thema ist virulent wie nie, ebenso wie die Zahl der Orte, wo überall dieser „Datenklau“ stattfindet, inzwischen unüberschaubar geworden ist. Die Verletzung des Urheberrechtes, so Tillig und Detjen, findet global statt. Dies wirksam zu unterbinden, sind die Menschen wie die Politik aufgefordert. Sie müssen schnell handeln, denn die Entwicklung von KI-Systemen galoppiert. Zu erwartende negative Folgen müssen eingefangen, der Wert des Individuums neu bestimmt werden. Zu Recht weisen die Autoren auf die Gefahren unregulierter, von KI gesteuerter digitaler Kommunikationsmedien hin: Manipulation der Nutzer, Diskriminierung ganzer Menschengruppen, politische Indoktrination. Russland und China sind auf diesem Weg schon weit, wir haben im Westen die Erfahrung medialer Beeinflussung 2016 beim Brexitreferendum und der Wahl des US-Präsidenten. Der Aufsatz kommt zur rechten Zeit.
Thomas Bettinger.